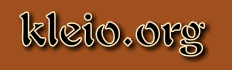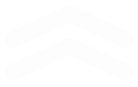Der Alltag im Mittelalter 352 Seiten, mit 156 Bildern, ISBN 3-8334-4354-5, 2., überarbeitete Auflage 2006, € 23,90
Bilder-Galerie

Friedrich I. war das dritte Kind und der dritte Sohn von Friedrich Wilhelm, dem Großen Kurfürsten von Brandenburg, und seiner ersten Gattin Louise Henriette von Oranien. "Er wurde am 11. Juli 1657 um neun Uhr vormittags in Königsberg geboren und in der lutherischen Schloßkirche, dem Ort seiner späteren Krönung, auf den Namen Friedrich getauft. Taufpaten waren Kaiser Leopold I., Ludwig XIV., Johann Georg von Sachsen und Christian Ludwig von Braunschweig-Lüneburg. Die Wahl der Paten war bezeichnend für die an Winkelzügen reiche Außenpolitik des Großen Kurfürsten ... Schon die Kindheit Friedrichs I. war beschattet von Erstickungsanfällen und Rückenschmerzen. Und so sehr sich auch der spätere König bemühte, die leidvollen Erfahrungen seiner Jugend zu verdrängen, sie hatten doch seinen Charakter geprägt. Ohne sie hätte er sich möglicherweise nie zu jenem pessimistischen, mißtrauischen und eitlen Menschen entwickelt, als der er später in die Geschichte eingehen sollte. Bei einer Reise der königlichen Familie über die holprige Straße nach Königsberg wurde der kleine Friedrich [als er sechs Monate alt war] durch einen Stoß von seinem Sitz geschleudert und verletzte sich die Wirbelsäule. Dieser Unfall brachte ihm einen Buckel und lebenslange Rückenschmerzen ein. Damit nicht genug, pflegte das Kind über seine nach innen verdrehten Füße zu stolpern, bis es dem berühmten Orthopäden Schot gelang, die prinzlichen Füße so weit zu begradigen, daß der junge Mann sich sogar zu einem gar nicht so schlechten Tänzer entwickeln konnte. Spaß hat ihm allerdings das Tanzen nie gemacht. Seine Rückenverletzung brachte es mit sich, daß der Knabe von seiner Mutter [Louise Henriette von Oranien] und Großmutter [Emilia von Solms-Braunfels (1602-1675), Prinzessin von Oranien] mit besonderer Ängstlichkeit gehegt und gepflegt wurde. Daß ihm das Reiten verboten wurde, war noch das kleinste Übel. Schlimmer waren die zahllosen Ärzte aus Holland und Deutschland, die an dem Kind eine Reihe von schmerzhaften Behandlungsmethoden ausprobierten und den Wehrlosen in alle möglichen orthopädischen Korsetts und Krücken zwängten. ... Schließlich brachte es ein Arzt namens Fay zuwege, daß Friedrich sich gerade halten konnte. Nur ein kleiner Buckel am Nacken erinnerte noch an seinen Unfall. ... Die mütterliche Luise [Louise Henriette] verging fast vor Sorge um ihr geliebtes zartes Fritzchen und verwöhnte ihn nach Strich und Faden. Während seines ersten Lebensjahres war er so oft krank, daß Luise ständig befürchtete, er würde ihr genommen werden wie schon ihr Erstgeborener." (in: Linda und Marsha Frey: Friedrich I. - Preußens erster König, ebenda, S. 33-34). Die Berliner nannten ihn wegen seines kleinen Buckels und des verwachsenen Rückens respektlos "den schiefen Friedrich".

Friedrich I. war der Liebling seiner Mutter, Louise Henriette von Oranien. "Verwachsen, klein und von labiler Gesundheit sowie empfindsam, leicht verletzlich und schwachen Charakters, entsprach Kurprinz Friedrich den Maßen des Vaters und den Anforderungen, die dieser an seinen Nachfolger stellen mußte, nicht im geringsten: Frische, Selbstbewusstsein und politischer Wille fehlten ihm vollständig." (in: Peter Mast, Die Hohenzollern in Lebensbildern, ebenda, S. 85).

Kaiser Leopold I. versprach dem Kurfürsten Friedrich von Brandenburg im November 1700 die Königskrone von Preußen, wenn jener ihm 8.000 Mann seines Heeres im Spanischen Erbfolgekrieg zur Verfügung stellen und bei der nächsten Kaiserwahl seine Stimme dem Hause Habsburg geben würde. "Es scheint so, als habe der Kurfürst noch vor einer Einigung mit dem Kaiser die Krönungsfeierlichkeiten vorbereiten lassen. Denn bereits am 15. Januar 1701, also zwei Monate nach Vertragsabschluß, verkündeten in den Straßen Königsberg in Preußen vier Wappenherolde, daß das Herzogtum Preußen zum Königreich erhoben worden sei. Am 18. Januar setzte Friedrich sich und seiner Gemahlin Sophie Charlotte im Königsberger Schlosse die preußische Krone auf das Haupt und schritt mit ihr an der Spitze des Krönungszuges zur Schloßkirche ..." (in: Peter Mast, Die Hohenzollern in Lebensbildern, ebenda, S. 87).
Sophie Charlotte von Braunschweig-Lüneburg und Hannover war übrigens seine zweite Gattin. In erster Ehe war er mit seiner Cousine Elisabeth Henriette von Hessen-Kassel (1661-1683) vermählt. Die beiden kannten sich schon als kleine Kinder, und aus der Kinderfreundschaft war letztendlich eine echte, tiefe Liebe geworden. Ihre Ehe war eine der wenigen Liebesheiraten in der Geschichte. Elisabeth Henriette starb jedoch bereits am 7. Juli 1683 an den Pocken. Es war nur eine Tochter aus ihrer Ehe hervorgegangen: Louise Dorothea Sophie (1680-1705). Seine zweite Ehe mit Sophie Charlotte von Braunschweig-Lüneburg und Hannover war hingegen wie seine dritte Ehe mit Sophie Luise von Mecklenburg-Schwerin, die gegen Ende ihres Lebens dem Wahnsinn verfiel, unglücklich.
Der Tagesablauf von Friedrich I.: "Er stand früh auf, in mittleren Jahren zwischen drei und vier Uhr morgens, später zwischen fünf und sechs, halb aus Gewohnheit, halb aus Pflichtgefühl. ... Beim offiziellen Lever pflegte der Kurfürst-König zwei Tassen Kaffee zu trinken, während er mit einigen vertrauteren Höflingen Konversation machte, um sich dann zu einer Stunde des Gebets zurückzuziehen. Danach empfing er seinen Sekretär zum Rapport über die Post und übernahm anschließend den Vorsitz über den Regierungsrat. Nach ungefähr einer Stunde zog er sich wieder in sein Zimmer zurück und traf von hier aus seine Anordnungen, den Tagesablauf betreffend. Das Mittagessen pflegte er allein einzunehmen, in späteren Jahren zuweilen mit seiner dritten Frau [Herzogin Sophie Luise von Mecklenburg-Schwerin (1685-1735)]. Danach wurde eine Stunde geruht, anschließend empfing er seine Frau oder den Premierminister. Seine Nachmittage verbrachte er im Sommer mit Jagen oder Fischen. Um fünf Uhr stattete er seinerseits der Königin einen Besuch ab, bevor er sich in das sogenannte Tabakzimmer begab, wo er mit privilegierten Mitgliedern des Hofes ein Pfeifchen rauchte. Zu Abend speiste er selten, wie er überhaupt im Essen und Trinken sehr maßvoll war. Dafür spielte er abends gerne eine oder mehrere Partien Schach oder Halma. An Musik und Tanz fand er kein Vergnügen, um so mehr genoß er die Späße der Hofnarren. Auch er selbst erzählte gerne etwas gewagte Geschichten. Um neun Uhr pflegte er sich zurückzuziehen. Da er diesen Tagesablauf mit wenigen Ausnahmen streng einhielt, bekam er seine zweite Frau, Sophie Charlotte, nur selten zu Gesicht, stand er doch schon wieder auf, bevor sie sich niederlegte. Noch weniger sah er seine Frau, wenn er reiste - und er reiste gerne und oft. Er liebte das Landleben und zog im Sommer und manchmal auch im Winter von Landsitz zu Landsitz." (in: Linda und Marsha Frey: Friedrich I. - Preußens erster König, ebenda, S. 58-59).
Friedrich war jedoch nicht ohne Qualitäten. Vor allem seine Zähigkeit und Beharrlichkeit fanden bei seinen Zeitgenossen Beachtung. "Bereits im achten Lebensjahr hatte er es sich in den Kopf gesetzt, seine Kusine, die Prinzessin [Elisabeth] Henriette von Hessen-Kassel, zu heiraten. Alles lachte nur über diesen kindischen Plan, und alle - bis auf die Mutter der kleinen Prinzessin - waren entschieden dagegen. Doch Friedrich hielt konsequent, still und unerschütterlich an diesem Ziel fest, so sehr sich auch sein gestrenger Vater, der Große Kurfürst, dagegen stemmen mochte, bis er 1679 in Potsdam seine geliebte Henriette vor den Traualtar führen konnte. Die Ungnade des Vaters, der ihn auf Schloß Köpenick verbannte und ihn vier Jahre lang, bis zum frühen Tod Henriettes, weder zu den Sitzungen des Geheimen Rates noch zu anderen Regierungsgeschäften hinzuzog, stand er stumm und unnachgiebig durch, ständig kränkelnd und leidend, immer bläßlich und unbedeutend, und doch innerlich heiter, in fester Liebe und Treue zu seiner Henriette, seiner ersten Frau." (in: Wolfgang Venohr: Der Soldatenkönig - Revolutionär auf dem Thron, ebenda, S. 41).

In der Renaissance und im Barock "bestimmte sich die politische Geltung in hohem Maße nach der Selbstdarstellung", die sehr viel kostete. Der königliche Hof von Friedrich I. stellte keine Ausnahme dar, das heißt, seinen Untertanen ging es nicht gut: "Die Feuersbrunst in der neumärkischen Stadt Krossen an der Oder im Jahre 1708 und die ostpreußische Pestkatastrophe der außergewöhnlich harten Winter 1709 und 1710 sowie ihr vorangehende wie nachfolgende Mißernten und Hungersnöte, die wohl auch auf Erschöpfung und Abstumpfung der Bauern infolge des hohen Steuerdrucks sowie den Verlust von Saatgut und Vieh infolge des Nordischen Krieges zurückzuführen sind, brachten erschreckende Tatbestände ans Licht. Das Fehlen von Getreide- und Geldreserven bei den Amtskammern, die die Anforderungen des Hofes längst aufgezehrt hatten, und leere Brandkassen, deren Einlagen unbefugterweise zweckentfremdet worden waren, zahllose Unterschlagungen und Versagen der Verwaltung, die am preußischen Massenelend Mitschuld trug, waren nur die Symptome dafür, daß der Staat insgesamt in einen Zustand der Erschöpfung und der Unordnung geraten war." (in: Peter Mast, Die Hohenzollern in Lebensbildern, ebenda, S. 94).

"Friedrich dagegen hatte zwar in seiner Jugend [wie seine zweite Gattin Sophie Charlotte von Braunschweig-Lüneburg und Hannover] Cembalounterricht erhalten, spielte aber als Erwachsener kein Instrument und zog den Klang von Trompeten und Trommeln vor. Dementsprechend groß war der Anteil dieser Instrumente innerhalb der Begleitmusik zur Krönungszeremonie [im Jahr 1701]. Wenn zum Schmettern der Trompeten und zum Wirbel der Trommeln Glockenläuten und Kanonendonner erschallte, dann war der König so richtig glücklich. Ein gewisser Lärmpegel mußte erreicht sein, um seine Macht überzeugend zu demonstrieren und die Pracht des Hofes gebührend zu unterstreichen. Die Berliner gewöhnten sich daran, daß beim geringsten festlichen Anlaß eine ohrenbetäubende Musik erschallte, und auch der Rhythmus des Hoflebens wurde von Trompeten und Trommeln begleitet." (in: Linda und Marsha Frey: Friedrich I. - Preußens erster König, ebenda, S. 106).

Friedrich I. hatte "eine fatale Schwäche für Menschen, die ihm schmeichelten."

"Die letzten Jahre des Königs [Friedrich I.] waren überschattet von den verschiedenen Enttäuschungen, die er im Westen und Osten erlebt hatte, aber auch von innenpolitischen und familiären Schwierigkeiten. Wartenbergs Sturz, der Tod seiner zweiten Frau [Sophie Charlotte von Braunschweig-Lüneburg und Hannover], seiner Tochter [Luise Dorothea (1680-1705)] und seiner beiden Enkel [Friedrich Ludwig (1707-1708) und Friedrich Wilhelm (1710-1711)] und schließlich die Geisteskrankheit seiner dritten Frau waren zu viel für einen Menschen, der ohnehin zu Depressionen neigte. Als es auch mit seiner eigenen Gesundheit bergab ging, gab er mehr und mehr Autorität an seinen Sohn [Friedrich Wilhelm I.] ab und ernannte ihn immer öfter zu seinem Stellvertreter. Der junge Prinz war in seiner äußeren Erscheinung und vom Temperament das genaue Gegenteil seines Vaters." (in: Linda und Marsha Frey: Friedrich I. - Preußens erster König, ebenda, S. 231). Am 25. Februar 1713 starb Friedrich I. in der Gegenwart seines Sohnes Friedrich Wilhelm I. an Lungenversagen.
als Buch
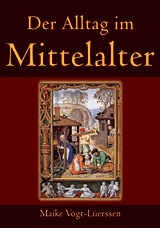
als Buch und als E-book

Zeitreise 1 – Besuch einer spätmittelalterlichen Stadt
als Buch, Independently published, 264 Seiten, 93 SW-Bilder, € 12,54, ISBN 978-1-5497-8302-9
und als E-Book
als Buch und E-book
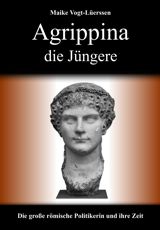
Agrippina die Jüngere – Die große römische Politikerin und ihre Zeit
als Buch bei amazon.de: 260 Seiten, mit Stammtafeln und 59 SW-Bildern, ISBN 3-8334-5214-5, 2., überarbeitete Auflage, € 17,90
als E-BOOK bei amazon.de: mit Stammtafeln und 70 Bildern, Eigenproduktion 2017, € 13,53