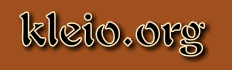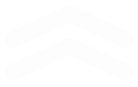Anna von Sachsen – Gattin von Wilhelm von Oranien
124 Seiten, mit Stammtafeln und 64 SW-Bildern, ISBN 978-1-9733-1373-1, 4. überarbeitete Auflage, € 7,80
bei amazon.de
Bilder-Galerie

Elisabeth von Hessen, die Gattin von Johann von Sachsen, als Witwe besonders unter ihrem Namen "Elisabeth von Rochlitz" (ihrem Witwensitz) bekannt, war bereits in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts eine eifrige Kämpferin für die Reformation. Der zeitgenössische Humanist Caspar Brusch beschreibt sie im Jahr 1544 folgendermaßen: "Rochlitz, das jetzt die kluge und geistvolle Schwester des hessischen Landgrafen Philipp mit großem Eifer und Fleiß regiert, eine angesehene Frau, anmutig und edel durch gewinnendes Spiel der Blicke und Augen, ... die wahre Hüterin der Sittsamkeit und edle Liebhaberin der Frömmigkeit." (in: Sachsens Heimliche Herrscher – Die starken Frauen der Wettiner, Ute Essegern (Hg.), Dresden 2008, S. 60). Elisabeth nannte seit dem 11. November 1517 Sachsen ihre zweite Heimat; sie selbst äußerte sich in einem Brief über ihre unglücklich verlaufende Ehe, die von ihrem Vater und ihrem Schwiegervater bereits im Jahr 1505 beschlossen worden wäre und gegen die sie sich im Jahr 1515 gesträubt hätte. Erst durch den Zwang und die Überredung ihrer Mutter und deren Räte willigte sie in die Heirat ein. Wenn Sie wissen möchten, wie Elisabeth wirklich ausgesehen hat, lesen Sie bitte meinen folgenden Artikel.

Elisabeth von Hessen, die Gattin von Johann von Sachsen, war eine für ihre Zeit ungewöhnliche Frau. Sie nahm kein Blatt vor dem Mund und sagte stets, was sie meinte und dachte. Und sie konnte so kräftig fluchen wie ihre männlichen Zeitgenossen. Wie jeder Frau (bis ins 20. Jahrhundert hinein), die es wagte, in der Politik oder in anderen wichtigen Angelegenheiten des Staates wie z.B. hinsichtlich der Religion mitsprechen zu wollen, oder die man als Gattin einfach loswerden wollte, hatte Elisabeth von Hessen sich ebenfalls gegen den Vorwurf des Ehebruches zu wehren. Die Ehre einer Frau durch diese Art von Beschuldigung zu verletzen, war ein alt- und langbewährtes Mittel, um weibliche Rivalen oder Intellektuelle entweder mundtot zu machen oder um eine neue Ehe eingehen zu können (siehe: Wilhelm von Oranien und Anna von Sachsen). "Die fortwährenden Spannungen [zwischen Elisabeth und ihrem Schwiegervater, Georg dem Bärtigen, und dessen Räte] verschärften sich durch Elisabeths spätestens seit 1526 fassbare Zuwendung zu Luther und mündeten schließlich seit 1532 in konkretere Vorwürfe über einen Ehebruch Elisabeths, die eben jetzt Beichte und Abendmahl verweigerte und ihr religiöses Bekenntnis damit in einer für Herzog Georg unhaltbaren Weise öffentlich machte. Für Elisabeths Ehre und religiöse Freiheit traten nachdrücklich Landgraf Philipp und Kurfürst Johann Friedrich ein ..." (in: André Thieme (Hg.): Die Korrespondenz der Herzogin Elisabeth von Sachsen. Erster Band: Die Jahre 1505 bis 1532. Leipzig 2010, S. XVI-XVII) (Ausschnitt eines Bildes im Sächsischen Stammbuch, Dresden, Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek)
Nach 1551 erkrankte Elisabeth mehrmals sehr schwer, am 6. Dezember 1557 segnete sie schließlich das Zeitliche. Ihr Leichnam wurde nach Marburg in die Elisabethkirche überführt und dort bestattet.

Das Epitaph von Elisabeth von Hessen, Herzogin von Sachsen und Herzogin von Rochlitz, befindet sich an der Westwand des Landgrafenchors. Sie war am 6. Dezember 1557 in Schmalkalden gestorben. Auf Befehl ihres Bruders, des hessischen Landgrafen Philipp I., wurde ihr Leichnam nach Marburg überführt und in der Elisabethkirche, wo bereits ihre Eltern, der hessische Landgraf Wilhelm II. und Anna von Mecklenburg-Schwerin, ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten, beigesetzt.

als Buch und E-book

Neu: Wer ist Mona Lisa?
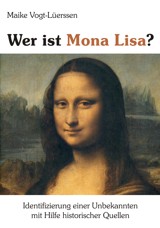
Wer ist Mona Lisa? – Identifizierung einer Unbekannten mit Hilfe historischer Quellen
als Buch bei amazon.de: 172 Seiten, mit Stammtafeln und 136 Bildern (130 Bilder in Farbe), Independently published, 1. Auflage, ISBN 978-1-9831-3666-5, € 29,31